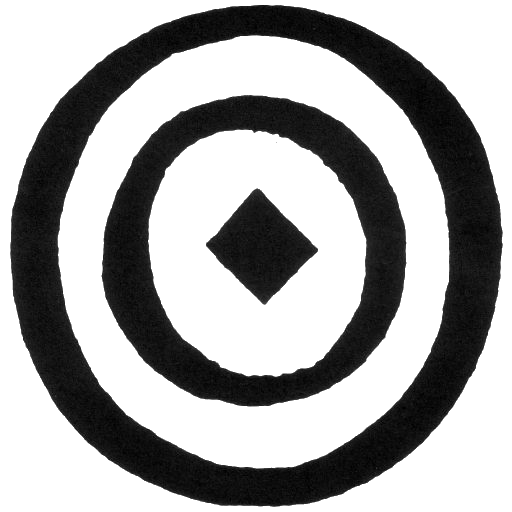Wie KI unsere Zukunft verändert, ist neben den Kriegen in der Ukraine und im Gaza-Streifen und dem Agieren des amerikanischen Präsidenten eines der zentralen Themen der Gegenwart. Für den Außenstehenden ziemlich plötzlich stehen wir vor ihr und begegnen ihr schon in unserem Alltag. Und die Frage ist berechtigt, worauf läuft das hinaus?
In der Wochenzeitung „Die Zeit“ las ich dazu vor einer Woche einen sehr guten Artikel des Ressorts „Wissen“. Der Artikel der Leiterin dieses Ressorts, Sybille Anderl, mit der Überschrift: „Wenn wir nicht mehr lernen müssen“, beleuchtet kritisch die Vision eines „kognitiven Schlaraffenlandes“ und verweist auf der Grundlage von Studien darauf, dass der Mensch erst Hindernisse überwinden müsse, um ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Spaß mache Lernen erst, wenn man selbst eine Aufgabe gelöst habe, die schwierig wirkte. Und genauso sei es für die meisten Menschen erfüllender, einen Berg selbst zu besteigen, als mit der Seilbahn auf den Gipfel zu fahren.
Wir sitzen hier in einem Kreis, nun einander zugewandt, nach 1 ½ Stunden Zazen, in denen wir auf die Wand vor uns geschaut und versucht haben, in einen Einklang mit unserem Atemgeschehen zu kommen und mit all dem in unserem gewöhnlichen Dasein. Mit dem, was uns, unseren Verstand vornehmlich, „da draußen“ im Alltag beschäftigt.
Auf dem Weg der Stille, vielfach – zumal am Beginn – empfunden als ein Weg zu einer erhofften oder gar ersehnten Stille hin, wo ist denn da eine Seilbahn, hin zu Höherem? Nun, ihr merkt es schon an meiner Rhetorik hier, da gibt es keine Seilbahn, keinen Aufzug, keine Rolltreppe o. ä. Da gibt es, was zunächst enttäuschend klingen mag, nur uns selbst – mit all unserem Gepäck, aber auch mit all unseren, uns oftmals nicht bewussten Möglichkeiten einer Selbstwirksamkeit, wie es in der modernen Psychologie bezeichnet wird.
Die auch für uns sicherlich schon erlebte belebende Erfahrung von Freude und Zufriedenheit, nach einer Anstrengung etwas (doch) geschafft oder erreicht zu haben, sollten wir ernstnehmen. Sie gilt auch für den Weg der Zen-Meditation/Zen-Kontemplation. Jeder, der ein mehrtägiges Sesshin, einen eintägigen Zazenkai oder auch einen solchen Abend wie heute „durch-sessen“ hat, wird diese Erfahrung schon gemacht haben oder sie machen. Auch gerade dann, wenn die Hindernisse sich in ihm meterhoch getürmt haben sollten, die Unruhe nicht weichen wollte, der Schmerz im Knie nicht enden wollte.
Und noch etwas aus dem Zeitungsartikel kann man für unsere Praxis fruchtbar machen. Die Verfasserin stellt darin die Vermutung an, dass dann, wenn die Seilbahn-Metapher stimme, die Gefahr bestehe, dass durch eine perfekte KI die Freude am Lernen wie auch die (intellektuelle) Neugier verschwinde. Seien aber Neugier und die Freude am Nachdenken nicht grundlegende menschliche Eigenschaften und dieses Denken selbst zu praktizieren und zu schärfen, nicht der Schlüssel für ein glückliches Leben? Wenn der Mensch sein Denken immer öfter der Maschine überlasse, verliere er dann nicht sich selbst?
Wer diesen Fragen tiefer in die Philosophie hinein folgt, stößt auf einen möglichen Denkfehler der technologischen Menschenverbesserer: Vielleicht ist die Vorstellung falsch, dass menschliche Begrenztheit automatisch schlecht ist und überwunden werden muss. Vielleicht macht ja gerade das den Menschen aus und gibt seinem Leben einen Sinn: dass er in einer unsicheren Welt voller existenzieller Gefahren lebt, von der er nur einen kleinen Ausschnitt versteht, weshalb er auf die Perspektive und das Wissen anderer Menschen angewiesen ist. Dass er mit Rückschlägen zu leben hat und versuchen muss, aus der Endlichkeit seines Lebens das Beste zu machen. Zumindest deckt sich das mit der Erfahrung, dass Menschen aus Krisen oftmals gestärkt hervorgehen. Dass sie nur aufgrund intensiver, auch unangenehmer Erlebnisse so etwas wie Lebensweisheit entwickeln. Existenzphilosophen wie Karl Jaspers und Martin Heidegger haben eindringlich betont, dass der Mensch sich erst dann selbst erkennt, wenn er mit Grenzsituationen seiner Existenz konfrontiert ist. Mit dem Tod, dem Zufall, mit Krankheit – und mit dem Scheitern.
Das bedeutet aber noch etwas anderes: Das Wissen, das man in digitalen Datenbanken sammeln und mit KI auswerten kann, hat Lücken. Es ist nicht dasselbe, ob man alles darüber weiß, wie man Fallschirm springt, oder ob man selbst mal gesprungen ist. Dem digitalen Wissen fehlt alle Körperlichkeit, und es gibt gute Argumente, dass unser Körper wichtig dafür ist, wie und was wir denken. Wenn wir von „Schmetterlingen im Bauch“ hören, verstehen wir die Bedeutung erst, sobald wir uns selbst das erste Mal verliebt haben. Wenn man selbst eine lange Reise gemacht hat, verändert einen das viel stärker, als wenn man aufmerksam einen dicken Reiseführer gelesen hat.
Und noch eine Lücke hat die Datenwolke: Auf viele Fragen gibt es in unserer komplexen Welt keine eindeutige Antwort. Auf ethische Fragen zum Beispiel.
…
Die naturwissenschaftlich beschreibbare Welt gibt darauf keine Antworten.
…
Das ist das grundsätzliche Problem an der Idee, uns Menschen mit technischen Mitteln immer schlauer zu machen: KI wird von Quantifizierbarem dominiert. Und sie vermittelt die Idee, dass es eine objektiv wahre Beschreibung der Welt geben könnte. Dabei vernachlässigt sie aber andere Wissensformen: implizites Erfahrungswissen, Intuition, echte Empathie, wirkliche Gefühle.
Alles, was du denkst, fühlst, wahrnimmst, äußerst und tust, geschieht durch deinen Körper, in deinem Körper. Es ist ein körperliches Geschehen. Alles, was du bist oder zu sein glaubst, bist du in deinem Körper, als dein Körper. Darauf verweist dich die Zen-Praxis in jedem Moment. Mal ausdrücklich, mal schweigend, mal subtil, mal quasi subversiv.
Und darauf, dass nicht nur, allgemein gesagt, Form Leere ist und Leere Form, dass Form nichts anderes ist als Leere, sondern dass auch und gerade dieser „dein“ Körper selbst Leerheit ist, worauf Thich Nhat Hanh ausdrücklich hinweist. Leer von einem getrennten Selbst.
Danke!
KF
(Impuls nach Abendmeditation am 11. 8. 2025)