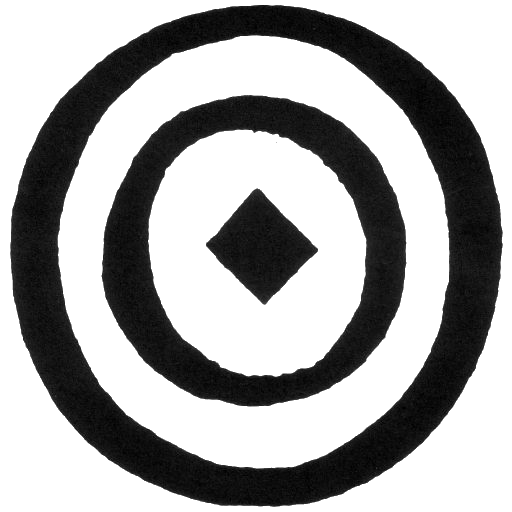Über ein Wirken von Dokusan
Manchmal, wenn wir im Vorraum zum Dokusan[2] sitzen, werden wir des Klangteppichs inne, der aus dem Dokusan-Raum zu uns dringt. „Nicht sind es Worte, nicht sind es Reden“ (Psalm 19,4), was uns da erreicht. Eher eine Lautkomposition des Augenblicks: leises Murmeln und Schweigen, das Anheben der auch uns mehr oder weniger vertrauten Stimme des Lehrers, seine herausfordernden Rufe, ein Crescendo der Stimmen, Lachen, ein Abebben im Schweigen. Ein Schöpfungsgeschehen anderer Art und doch in der Spur des zitierten Psalmworts.
Was wir auf diese Weise in absichtslosem Sitzen wahrnehmen, was durch die schützenden Wände und Türen zu uns dringt und für unseren gewöhnlich erfassenden Geist nicht zu entziffern und nicht zu verstehen ist: Was hat es eigentlich mit uns zu tun und was macht es mit uns? Worauf stimmt es uns ein?
Keinesfalls ist es so, dass das, was uns im berechtigt strengen Sinne nichts angeht, weil es aus dem Dokusan eines anderen zu uns dringt, uns nicht anginge. Vielmehr disponiert es mühe- und absichtslos, gleichsam in atmosphärischer Selbstwirksamkeit für eine Anderart[3] der Begegnung in einer Anderart der Wahrnehmung, die uns selbst nach dem Erklingen des Dokusan-Läutens und dem Heraustreten des Vorgängers oder der Vorgängerin in das Innere dieses Raumes führt, in die Unmittelbarkeit der Begegnung.
Und wo wir uns dieser Führung überlassen haben, mag es sein, dass uns alles entglitten ist, was zu sagen uns vordem so wichtig erschien. Und auch wo wir der Konditionierung nicht zu widerstehen vermögen, in einer uns abgerungenen Anstrengung des Geistes Zurechtgelegtes wieder hervorzuholen und in Worte zu bringen; und auch wo beide Seiten der Begegnung Zuflucht nehmen mögen zur Arbeit mit der „Fischreuse oder dem Jagdnetz der Worte und Buchstaben“ (Dogen Zenji): Das Nachwirken der atmosphärischen Disposition aus dem absichtslos sitzenden Warten vermag unsere Sinne aufzuschließen für das Vernehmen eines Sub- und Andertextes dieser Begegnung – für das, was der Lehrer lehrt durch seine leibhaftige Präsenz.
Was geht von ihm aus, in uns ein – aus seiner aufschauenden Bewegung, seinem eröffnenden Blick, der Resonanz seiner Gesichtszüge, seinem sitzenden Körper, dem Klang seiner Stimme? Was hat es auf sich mit der Anderkraft, die von ihm ausgehend spürbar wird im Identitätspunkt des eigenen Brustbeins, dem Begegnungsort des eigenen Herzraums?
Als würde ein gespürtes Inbild des Anderen, in der Auswirkung der Gestalt Lehrers auf uns, in uns gemalt – mit dem Pinselstrich dieses Augenblicks, in der Fülle der Pinselstriche der Augenblicke der einander folgenden Dokusan-Begegnungen dieses Sesshins, dieses Lehrer-Schüler-Weges, dieses Ein-Ander des Lebens als Begegnung.
Was mag es in uns und für uns und mit uns und durch uns bewirken, auswirken und freisetzen, dieses Inbild des Lehrers – gewirkt nicht zuletzt aus seinen Inbildern seiner Lehrer in ihm? Ist dieses Wirken wirklich einzufangen mit der „Fischreuse oder dem Jagdnetz der Worte und Buchstaben“? Erschöpft es sich in der Endlichkeit unseres Lebens oder geht es nicht vielmehr ins Unendliche des Lebens, wo es wirklich Ein-Ander der Begegnung ist?
Und doch:
Was wirkt sich jetzt in ihm aus, will sich zeigen und gezeigt werden, ganz konkret, in diesem Moment?
Und doch:
Was wirkt sich wirklich aus in jedem Dokusan?
„Nicht sind es Worte, nicht sind es Reden“ …
Justinus Jakobs, Münster
[1] Muss wirklich eigens gesagt werden, dass mit „Meister“ und „Lehrer“ in diesem Text selbstverständlich auch die Meisterin und die Lehrerin gemeint ist? Und sollten wir mit „Meister“ und „Lehrer“ zugleich auch die Christus- oder Buddha-Wirklichkeit assoziieren – wogegen nichts einzuwenden wäre: um wie viel mehr wäre dann klar, dass es um alle konkreten Formen und Gestalten von Geschlecht und Gender unseres Menschseins in Begegnung geht.
[2] Dokusan (jap.) ist das persönliche Gespräch zwischen Lehrer und Schüler im sog. Dokusan-Raum. Es findet parallel zur laufenden gemeinschaftlichen Meditation und ebenfalls in Meditationshaltung statt.
[3] Die Wortschöpfungen „Anderart“ und im Folgenden „Andertext“ oder „Anderkraft“ sind nicht zuletzt inspiriert von der Philosophie Emmanuel Levinas‘ und der Theologie Hans-Joachim Sanders. Beide können als „Gesprächspartner“ für Zen-Übende, gerade für solche aus der jüdisch-christlichen Tradition, sehr empfohlen werden.