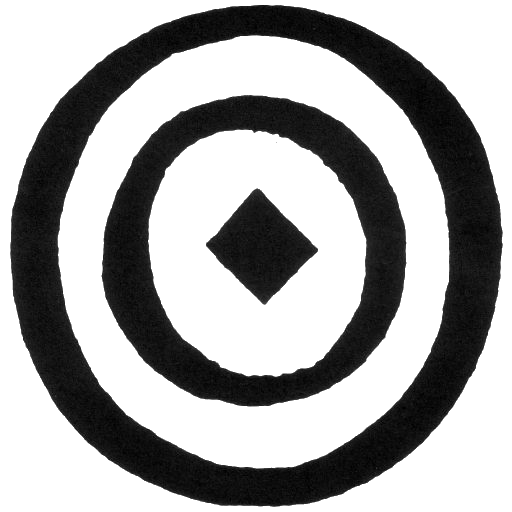Ein amerikanischer Psychologe[1] hat jüngst ein Buch veröffentlicht über (staunende) Ehrfurcht als ein Gefühl, in der Gegenwart von etwas Großem zu sein, das unser eigenes Verständnis der Welt übersteige. So sei Ehrfurcht ein besonderer Weg zum Glück, überall und für alle praktisch leicht zugänglich. Sie beruhige, mache wachsam in Bezug auf die eigenen Absichten und öffne den Menschen für die größere Sinngeschichte des Lebens. Auch mache sie den Menschen offenbar weniger narzisstisch.[2]
Ehrfurcht (engl. awe) mit seinen Elementen von Staunen und auch Scheu beinhaltet, wenn wir sie erleben/empfinden/äußern, zwei wesentliche sich nur oberflächlich betrachtet gegenüberstehende Elemente. In Wirklichkeit hängen diese miteinander zusammen und ergeben so ein Ganzes: Distanz zu sich selbst und zugleich größere, tiefere Verbundenheit mit allem. Und je größer die Distanz zu uns selbst (verstanden als unser gewöhnliches Ich) wird, umso größer wird die Verbundenheit mit allem. Je mehr das Ego zurücktritt, je mehr Raum ist für alles rundherum. Daher ist in der Tat Ehrfurcht ein Bestandteil jeder ernsthaften Meditation und umfassender gesagt: jedes Menschen, der sich als Übenden sieht – und dies nicht nur auf dem Kissen, Bänkchen, Hocker oder Stuhl, sondern in seinem ganzen Leben.
Ehrfurchtsmomente, seien es solche im Erleben von menschlicher Größe, der Natur, der Musik, der Kunst allgemein, der Spiritualität und Religion, der Vergänglichkeit, der Leerheit und Einheit, zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass wir in diesen Momenten nicht Handelnde, sondern Erlebende, Nicht-Handelnde sind. Wir nehmen wahr, dass wir nicht sofort reagieren, wie wir es sonst gewöhnlich tun, sondern dass wir innehalten, sozusagen innegehalten werden. Der innere Kritiker, die ansonsten mehr oder weniger immer aktive innere Stimme in unserem Kopf, die alles kommentiert, einordnet, bewertet, kritisiert oder lobt, ist einen kleinen Moment ruhig. Dann können wir alsbald beobachten, wie wir wieder in einen Reflexionsmodus kommen und das gerade Erlebte einzuordnen versuchen. Das ist ganz natürlich. Kein Problem darin.
Problematisch wird es erst dann, wenn wir versuchen, das Erleben willentlich zu wiederholen oder zu verstärken. Das ist die eine Versuchung, wie sie sich ähnlich zeigt, wenn wir in der Stille der Meditation Momente von „Glückseligkeit“ erfahren. Glückseligkeit, ein ältlicher Begriff, der aber recht gut umschreibt, wie wir uns da fühlen. „Oh,“ sagen wir, „toll; das möchte ich noch mal erleben.“ „Mehr, mehr“, sagen wir, wie es der kleine Häwelmann in der Erzählung von Theodor Storm zum Mond sagt. Aber das funktioniert nicht. Wir geraten dann in eine Anhaftung. Und das ist eine von den Leidenschaften oder Geistesgiften, die es zu „überwinden“ gilt.
Die andere Versuchung ist diese: Ich versuche weiterhin willentlich glücklich zu werden, indem ich mein Meditationsprogramm verschärfe, mich noch stärker zu konzentrieren versuche, meinem Alltagstress zu entkommen versuche auf der Suche nach dem Weg zum Glück, über dessen Beschaffenheit ich aber nicht einmal eine valide Aussage machen könnte. Wie ein Glücksforscher, aber in eigener Sache. Und da genau liegt auch der Haken. In eigener Sache! Was ist aber ein Merkmal von Ehrfurcht? Distanz zu sich selbst erfahren; das Ego zurücktreten lassen!
Je mehr wir auf eine solche, allein willentlich vorangetriebene, Weise versuchen wollen, beispielsweise ein achtsames, entschleunigtes und glückliches Leben zu führen und alles, aber auch wirklich alles, richtig zu machen, umso mehr erhöhen wir das Risiko, dass die Suche nach dem Glück ins Gegenteil umschlagen kann, weil eine solche „Willens-Kontrolle“ nicht oder nur bedingt funktioniert.
Der Punkt ist hier der: Man kann nicht immer im gewöhnlichen Sinne glücklich sein. Man kann nicht immer entspannt sein. Das Leben hält immer seine Herausforderungen bereit. Das Leben selbst ist die größte Herausforderung! Und das hängt – machen wir nicht die Augen davor zu – damit zusammen, dass wir sterbliche Wesen sind. Das ist die größte Herausforderung für unser Bewusstsein. Das und die daraus resultierende Angst vor der Endlichkeit, dem Tod.
Und an dieser Stelle meldet sich Zen. Denn Zen sagt Dir, ergreife die Gelegenheit, widme dich mit ganzem Ernst dem Zazen, und entrinne dem dualen Verständnis von Leben und Tod. Nicht dass du unsterblich würdest, sondern indem du die Angst überwindest. Und wie? Indem Du erwachst in dem Sinne, dass im Grunde alle Lebewesen und Erscheinungen leer sind, keine eigenständige aus sich heraus wirksame Substanz aufweisen. Und dass in einer solchen Erfahrung sich das Eins-Sein zeigt. Gut und Böse und all die normalen Bewertungskategorien sind in dem Moment hinfällig, zeigen sich in ihrer Relativität, und so auch Leben und Tod.
Wie heißt es im Gedicht von Meister Mumon zu dem Koan „Alltäglicher Geist ist der Weg“[3]:
„Die Blumen im Frühling – der Mond im Herbst,
Im Sommer die kühle Brise – im Winter der Schnee.
Wenn unnütze Sachen den Geist nicht vernebeln,
ist dies des Menschen glücklichste Jahreszeit.“
Ehrfurcht ist zugleich Ausdruck von dem – mehr noch, es ist zugleich das –, auf das sich unsere Ehrfurcht richtet.
Wenn ein Sprung in eine solche die gewöhnlichen Kategorien sprengende Wahrnehmung erfolgt, ist dies ein Sprung vom bloßen Gefühl des Staunens, der Ehrfurcht, der Scheu oder gar der Furcht hin zu einer Haltung.
Was meine ich damit?
Staunende Ehrfurcht vor dem Faktum des Lebens in jeglicher Ausgestaltung und Beziehung und so direkt, unmittelbar und unzweifelhaft selbst Faktum des Lebens zu sein, das ist Praxis!
Schlichte Realisierung der ohne Grenzen existierenden Lebens-Wirklichkeit ohne jedes Beiwerk, das ist die Haltung, die sich in der Praxis manifestiert. Dann kannst du erstaunt und beglückt ausrufen: All dies bin ich, weil es einfach so ist.
Deshalb habe ich für diesen Impuls in der Überschrift der „Ehrfurcht“ hinzugefügt: „Vom Gefühl zur Haltung.“
Danke!
Klaus Fahrendorf (Cloud of merciful Awareness)
(Abendimpulse vom 27. 1. und 10. 2. 2025)
[1] Dacher Keltner
[2] Siehe Interview in der SZ vom 23. 5. 2025
[3] Mumonkan Nr. 19.